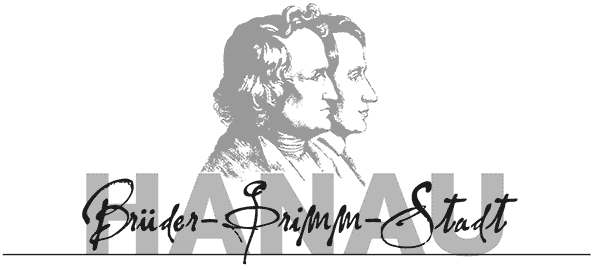Gedenkstätte Ehemalige Ghettomauer
Am 27. Januar 1945, heute vor 80 Jahren, befreite die Rote Armee das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Mit dem Beschluss über die „Endlösung der Judenfrage“ am 20. Januar 1942 auf der sog. Wannseekonferenz hatte das NS-Regime beschlossen, alle Jüdinnen und Juden Europas industriell zu ermorden. In den ab 1933 zunächst für politische Gegner eingerichteten Konzentrations- und Vernichtungslagern im Deutschen Reich, wurden ca. sechs Millionen Jüdinnen und Juden umgebracht – alleine in Auschwitz-Birkenau etwa 1.100.000 Menschen.
Unter ihnen befinden sich auch Hanauer Jüdinnen und Juden. Um ihnen namentlich zu gedenken, wurde 2010 am Freiheitsplatz die „Gedenkstätte Ehemalige Ghettomauer“ eingeweiht. Die Mauer begrenzte einst das Anfang des 17. Jahrhunderts unter Graf Philipp Ludwig II. von Hanau-Münzenberg durch eine „Judenstättigkeit“ errichtete Ghetto. Es bestand bis 1806, als napoleonische Truppen mit der Einführung des Code Civil die Tore des Viertels einrissen und die Diskriminierung der jüdischen Bevölkerung vorübergehend beendeten. Von da an konnten die Familien ihren Wohnsitz innerhalb der Stadt frei wählen. Die Jüdische Gemeinde Hanau zählte 1932, vor ihrer Verfolgung, Entrechtung und Vernichtung, 630 Personen. Erst 2005 wurde sie wieder gegründet und hat heute rd. 200 Mitglieder.
Zur Einweihung der individuellen Namenstäfelchen am 30. Mai 2010 kamen die damalige Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland Dr. Charlotte Knobloch und der Vorsitzende des Landesverbandes Hessen Moritz Neumann sel. A. Nach einem mehrjährigen Gedenkprozess sprachen sich Jüdische Gemeinde, Kirchen, Vereine und Stadtpolitik einvernehmlich dafür aus, alphabetisch geordnete Bronzetäfelchen an diesem zentralen Gedenkort für Hanau anzubringen. Sie ergänzt die offizielle Gedenkstätte in Erinnerung an den Standort der Synagoge in der Nordstraße (bis 1898 Judengasse) und am Gleis 9 des Hanauer Hauptbahnhofs eine Erinnerungstafel in Erinnerung an die beiden Deportationen vom 30. Mai und 5. September 1942. Auch in Großauheim und Klein-Auheim stehen Gedenktafeln für die verfolgten und ermordeten jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. In Steinheim wurden zudem Stolpersteine vor ehemaligen Wohnhäusern verlegt.
Viele Nachkommen finden die Gedenkform mit Bronzetäfelchen sehr gelungen, zumal an dem Ort ihre Familienmitglieder zusammengeführt werden. Durch Kontakte in aller Welt und Forschungen über die jüdischen Hanauerinnen und Hanauer können immer wieder neue Namenstäfelchen ergänzt werden. Inzwischen sind es 235 Plaketten. Die Eingangstafel trägt eine zeitlose Mahnung: „Menschlichkeit erwächst aus der Verantwortung für die Vergangenheit“.
Text: Martin Hoppe
 Bronzetäfelchen für Max Sichel, geb. 27. Januar 1901 in Hanau, ermordet am 14. September 1943 in Auschwitz (© Fachbereich Kultur der Stadt Hanau, Aufnahme: Martin Hoppe)
Bronzetäfelchen für Max Sichel, geb. 27. Januar 1901 in Hanau, ermordet am 14. September 1943 in Auschwitz (© Fachbereich Kultur der Stadt Hanau, Aufnahme: Martin Hoppe)
 Gedenkstätte Ehemalige Ghettomauer (© Fachbereich Kultur der Stadt Hanau, Aufnahme: Martin Hoppe)
Gedenkstätte Ehemalige Ghettomauer (© Fachbereich Kultur der Stadt Hanau, Aufnahme: Martin Hoppe)