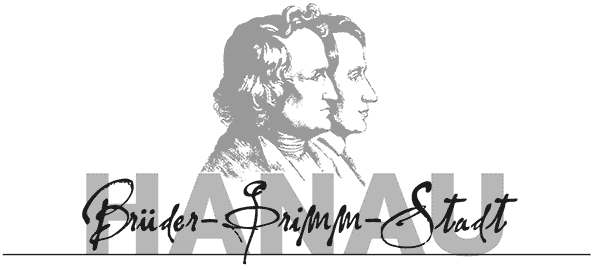Grabstele von Albrecht Glenz
Er gilt als einer der bedeutenden Bildhauer der Region: Albrecht Glenz. Vor 35 Jahre ist er verstorben, am 6. Februar 1990. Nachdem die Ruhestätte der Familie auf dem Friedhof Erbach / Odenwald 2022 geräumt wurde, konnte in einer „konzertierten Aktion“ von Tochter Susanne Voß, evangelischer Kirche Wolfgang, Künstlerbund Simplicius, Stiftung der Sparkasse Hanau, privater Spenden und Stadt Hanau sein Grabstein an die Luther-Kirche nach Hanau-Wolfgang versetzt werden. Da Glenz das dortige Ensemble Altar-Kreuz, Kanzel, Taufstein und Leuchter aus Aluminiumguss 1965 gestaltete und dort weiterhin „Lebensbäume“ und die Plastik „Richtstuhl“ von ihm aufgestellt wurden, ergänzt sich alles zu einem kleinen aber feinen „Glenz-Kunstzentrum“.
Albrecht Glenz wurde am 6. August 1907 in Erbach als Sohn des Elfenbeinschnitzers und Lehrers an der Zeichenakademie Otto Glenz und Minna, geb. Arrass geboren. Von 1912 bis 1916 besuchte er die Grundschule in Hanau, 1916–1925 das Gymnasium in Michelstadt, 1925/26 die Fachschule für Elfenbeinschnitzerei in Erbach, 1926/27 die Kunstakademie München bei Joseph Wackerle und 1927–1932 die Kunstakademie Düsseldorf bei Richard Langer.
Es folgten Studienaufenthalte in Paris und Spanien, ehe er als selbstständiger Bildhauer mit Atelier an der Städelschule in Frankfurt tätig war. 1940 nahm er noch an der Großen Deutschen Kunstausstellung in München teil, danach folgten Kriegsdienst und US-Gefangenschaft. Nach seiner Rückkehr avancierte er 1947-1955 zum Direktor der Fachschule für Elfenbeinschnitzerei in Erbach, danach war er bis 1970 Dozent für Modellieren und Elfenbeinschnitzen an der Staatlichen Zeichenakademie Hanau.
Bis zu seinem Tode engagierte er sich als freischaffender Bildhauer und als Mitglied der Neuen Darmstädter Sezession, im Berufsverband Bildender Künstler, im Bund Hessischer Kunsthandwerker und im Künstlerbund Simplicius Hanau. An Ehrungen erhielt er die Ehrenplakette des Hessischen Ministerpräsidenten in Silber für Elfenbeinarbeiten (1963) und die August-Gaul-Plakette der Stadt Hanau (1982).
Bekannte Werke von ihm sind etwa der Postreiter in Frankfurt (1951), Altar-Kreuze und Leuchter für die Christus-Kirche und Kreuzkirche Hanau (1962/1966), eine Großplastik für den Schwurgerichtssaal im Gerichtsgebäude Hanau (1969/70, heute in Idstein), „Die Sechs Schwäne und ihre Schwester“ (1980/81, ehemals Hammerstraße, jetzt Schlossgarten als Teil des Hanauer Märchenpfads durch die Innenstadt, siehe OdW #122), den Porträtkopf von Schriftsteller Rudolf Hagelstange (1984, im Kulturforum Hanau) und der Porträtkopf von Kurt Schumacher (1986, auf dem gleichnamigen Platz in Kesselstadt). Ein großer Teil seines Nachlasses, Arbeiten aus Elfenbein, Holz, Bronze, Kupfer und Stein, aber auch Grafik, befindet sich im Bestand der Städtischen Museen Hanau, die 1993 eine große Retrospektive im Schloss Philippsruhe zeigten.
Die Stele aus Muschelkalk von rd. 160 cm Höhe schuf Glenz nach dem Tod seiner zweiten Ehefrau Ellen, geb. Stenger, 1975. Sie zeigt eine Stimmgabel mit schwebenden Tönen, eine Akkord-Folge in F-Dur.
Text: Martin Hoppe
 Grabstele von Albrecht Glenz vor der Luther-Kirche in Hanau-Wolfgang (© Fachbereich Kultur der Stadt Hanau, Aufnahme: Martin Hoppe)
Grabstele von Albrecht Glenz vor der Luther-Kirche in Hanau-Wolfgang (© Fachbereich Kultur der Stadt Hanau, Aufnahme: Martin Hoppe)